Nicole MÜHL / 22. August 2025
© Chiara Pieler
Tierschutz fällt im Burgenland in das Ressort der Grünen Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner. prima! Herausgeberin Nicole Mühl hat sie und Klubobmann Wolfgang Spitzmüller zum Interview gebeten.
Tierheim Süd – Status quo
Die neue rot-grüne Landesregierung hat den Bau eines Tierheims für den Süden des Burgenlandes angekündigt. Wie ist der aktuelle Stand der Umsetzung dieses Vorhabens?
Anja Haider-Wallner: Wir sind jetzt im Prozess, einen Standort zu suchen. Dafür haben wir die Suche auf die Bezirke Güssing und Jennersdorf eingegrenzt und die Kriterien definiert. Derzeit bringen wir einen Regierungsbeschluss auf den Weg, damit die Landesimmobilien Burgenland auch offiziell den Auftrag dafür erhält. Spätestens im Frühjahr 2026 haben wir dann einen Standort mit einer genauen Analyse: Wie kann dort gebaut werden? Was wird es kosten? Damit können wir in den Planungsprozess starten. Wenn Standort, Kosten und Planung vorliegen, kann die Regierung den Auftrag zum Bau erteilen. So sieht der Zeitplan aus. Ein wichtiges Kriterium ist für mich, dass wir vorrangig keine neuen Flächen versiegeln, sondern ein bestehendes Objekt umbauen, also bereits versiegelte Flächen nutzen. Aber mir ist wichtig, Naturschutz und Tierschutz nicht gegeneinander auszuspielen, sondern beides zu vereinen – auch wenn das die Suche nicht einfacher macht.
Als möglicher Standort war der Norden des Bezirks Güssing – eventuell die Gemeinde Stegersbach – im Gespräch. Ist das aktuell?
Wolfgang Spitzmüller: Wie gesagt, ist noch alles offen. Unsere Anforderung ist, dass alle Menschen im Burgenland in maximal einer Stunde ein Tierheim erreichen. Das ist in der Zielvereinbarung festgelegt. Die Entscheidung, die wir jetzt treffen, soll langfristig die beste Lösung bringen. Deshalb stecken wir mehr Energie in die Suche, um den optimalen Standort zu finden. Dazu gehört auch, dass er außerhalb des Ortsgebiets liegt, um Lärm- und Geruchsbelästigungen zu vermeiden.
Handelt es sich bei dem geplanten Projekt um ein Tierheim oder vielmehr um einen Gnadenhof beziehungsweise eine Einrichtung zur Unterbringung nicht vermittelbarer Hunde?
Haider-Wallner: Die Einrichtung wird etwas kleiner als der Sonnenhof in Eisenstadt. Es werden Katzen, Hunde und Kleintiere aufgenommen zur Vermittlung. Es gibt aber schon Überlegungen, schwer vermittelbare Hunde eher im Süden unterzubringen. Geplant ist, mehr Freiflächen zu schaffen für Gruppenhaltung, was im Sonnenhof nicht im gewünschten Ausmaß gegeben ist. Insbesondere für Hunde, die länger bleiben, um sie zu trainieren und sozial verträglicher zu machen, damit sie in die Vermittlung kommen.
Wann ist die Verwirklichung des Tierheims im Südburgenland realistisch?
Haider-Wallner: Mit Vorliegen der Machbarkeitsstudie im Frühjahr 2026 werden wir einen Zeitplan haben.
Tierschutzgipfel – für klarere Rahmenbedingungen
Wird die Leitung des geplanten Tierheims Süd zentral vom Norden aus übernommen – also vom Sonnenhof aus mitgeleitet – oder ist vorgesehen, eine Person mit der Führung zu betrauen, die sich bereits im Tierschutz im Süden bewährt hat, über ein bestehendes Netzwerk verfügt, mit den regionalen Gegebenheiten vertraut und in den Gemeinden bekannt ist?
Haider-Wallner: Es gibt derzeit noch keine konkreten Überlegungen. In den letzten Monaten habe ich viele Gespräche geführt, mit Behörde, Ehrenamtlichen, Vereinen etc. – oft mit sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen der Situation. Grundsätzlich ist mir wichtig, dass wir nach Konflikten der Vergangenheit zwischen Institutionen und Ehrenamtlichen eine Gesprächsbasis finden. Deshalb wird es Anfang nächsten Jahres einen Tierschutzgipfel geben, zu dem wir Ehrenamtliche, Vereine, Amtstierärztinnen, die Veterinärdirektion und den Sonnenhof einladen. Ziel ist, gemeinsam den Tierschutz so zu gestalten, dass auch Ehrenamtliche bessere Rahmenbedingungen vorfinden. Dabei wollen wir klären, wo die Knackpunkte liegen. Wichtig ist auch, die Gemeinden einzubeziehen, denn laut Gesetz sind sie für Fundtiere zuständig.
Spitzmüller: Hier braucht es Aufklärungsarbeit auch in den Gemeinden. Aufklärung ist ebenso nötig bei Tierhalterinnen und Tierhaltern, etwa zur Kastrationspflicht. Ehrenamtliche kümmern sich derzeit oft aufopferungsvoll darum, weil Besitzerinnen und Besitzer ihrer Verantwortung nicht nachkommen. Wir bereiten deshalb eine Aufklärungskampagne zur Kastration von Freigängerkatzen vor, denn dort beginnt das Problem eigentlich.
Im Burgenland wird das Ehrenamt ja sehr groß geschrieben – im Tierschutz hat man aber den Eindruck, es wird kaum anerkannt. Warum?
Haider-Wallner: Das Gegenteil ist der Fall. Ehrenamt ist für uns gerade im Tierschutz sehr wichtig. Die vielen großen Aufgaben lassen sich nur bewältigen, wenn alle zusammenarbeiten – Hauptamtliche und Ehrenamtliche. Deshalb braucht es auch den Gipfel. Einige Überlegungen möchte ich dort zur Diskussion stellen, beispielsweise die Einführung einer Ehrenamtsversicherung für Menschen, die im Tierschutz tätig sind oder Schulungen. Ich bin der Meinung, diese Ideen müssen mit den Betroffenen besprochen werden. Unser Ziel ist klar: Wir wollen den Burgenländerinnen und Burgenländern eine Servicestelle für den Tierschutz bieten. Letztlich wollen alle, dass es den Tieren gut geht. Aber es gibt unterschiedliche Sichtweisen, Dinge, die schieflaufen, es ist zu wenig Geld im System vorhanden und eine Überforderung bei vielen Tierschützer:innen, die oft an ihre Grenzen gehen.
Spitzmüller: Wichtig ist, dass die Menschen eine Servicestelle haben und jene, die sich im Tierschutz besonders engagieren, entlastet werden. Wir können Ehrenamtlichen nicht die gesamte Arbeit abnehmen, aber es soll eine sinnvolle Aufgabenteilung geben. Ich halte das Ehrenamt für sehr wichtig und sehe es ein wenig wie bei der Feuerwehr. Auch im Tierschutz soll das so bleiben. Ehrenamtliche sollen jedoch nicht überfordert werden und, wie die Feuerwehr, Unterstützung vom Land erhalten. Wir müssen ein Gleichgewicht finden – daran arbeiten wir mit dem Tierschutzhaus im Süden und einer besseren Zusammenarbeit. Ich möchte nicht, dass das Land alles übernimmt, weil das ein funktionierendes System ist – trotz aller Widrigkeiten.
Tier gefunden – Gemeinden sind verantwortlich
Halten Sie die Erreichbarkeit der zuständigen Stellen in Sachen Tierschutz für ausreichend? Konkret: Was geschieht, wenn man an einem Samstagnachmittag ein Fundtier entdeckt?
Haider-Wallner: Also für behördliche Abnahmen sollte der Sonnenhof immer erreichbar sein. Bei Fundtieren ist die Gemeinde verantwortlich und dafür zuständig, das Tier zu verwahren, bis es in den Sonnenhof kommt. Das ist in der Verordnung so geregelt.
„
Für Fundtiere
sind die Gemeinden
zuständig.
„
LH-Stv. Anja Haider-Wallner
Ist das auch den Gemeinden bewusst? Oft landen die Tiere wieder bei Ehrenamtlichen – eben weil niemand erreichbar ist oder die Gemeinde keine Unterbringungsmöglichkeit hat.
Spitzmüller: Wissen tun sie es natürlich, aber nicht alle haben auch entsprechende Maßnahmen gesetzt. Das Problem ist uns bewusst. Deswegen müssen wir die Gemeinden auch in den Tierschutzgipfel miteinbeziehen. Wie überall gibt es welche, die besser und welche, die weniger gut arbeiten – ähnlich wie bei den Kastrationsgutscheinen. Das funktioniert in manchen Gemeinden sehr gut, in anderen weniger. Dafür braucht es konkretes Feedback, wenn es irgendwo nicht klappt. Bei Beanstandungen bitte gern direkt an unser Büro melden, damit wir dort nachfragen können.
Da Fundtiere meist abends oder am Wochenende auftauchen – wenn niemand in der Gemeinde erreichbar ist – stellt sich die Frage: Wie soll man in solchen Fällen vorgehen?
Haider-Wallner: Zuständig ist die Gemeinde. In der Gemeinde muss es immer einen Notdienst geben, denn es kann Probleme mit dem Kanal oder der Straßenbeleuchtung geben. Meistens ist dieser Dienst im Bauhof angesiedelt oder wird von den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern persönlich übernommen. Der Bürgermeister ist ja auch erreichbar, wenn es irgendwo Hochwasser gibt.
Ist die Kastrationsgutscheinaktion für Streunerkatzen weiterhin gesichert?
Haider-Wallner: Für das nächste Jahr ist sie wieder budgetiert. Die Mittel sind knapp – auf allen Ebenen, bei den Gemeinden, beim Land und beim Bund. Dennoch haben wir gesichert, dass sie wie bisher weiter abgewickelt werden kann.
Privatabgaben: Tiere, die nicht mehr behalten werden und hinterbliebene Tiere sind in der Verantwortung des Besitzers bzw. Erben
Tierschützer berichten von steigenden Privatabgaben – etwa wenn Tiere nach dem Tod ihrer Besitzer von den Nachkommen nicht übernommen werden.
Wer ist in solchen Fällen zuständig, und welche Lösungen gibt es, um zu verhindern, dass diese Tiere auf der Straße landen?
Haider-Wallner: Grundsätzlich muss man festhalten, dass das Tier in der Verantwortung der Nachkommen liegt. Ihnen muss klar sein, dass Kosten für die Unterbringung des Tieres anfallen, wenn sie es nicht selbst versorgen – hier braucht es vermutlich noch mehr Aufklärung. Ab dem Zeitpunkt, an dem ein Mensch stirbt, ist sein Tier Teil der Verlassenschaft. Der Notar, der das Erbe abwickelt, sorgt dann dafür, dass die Unterbringung bezahlt wird. Hier gute Lösungen anzubieten ist ein Punkt, den wir auch beim Gipfel klären müssen.
Wie viele Katzen werden tatsächlich im Sonnenhof abgegeben und wie viele landen einfach auf der Straße bzw. werden zurückgelassen?
Spitzmüller: Bei Hunden passiert das sicher weniger, weil sie ja gechippt sind. Bei Katzen können wir es nicht sagen. Aber wir haben das auf unserer Liste als Thema für den Tierschutzgipfel. Mittelfristig wird das Tierheim im Süden hier Entlastung bringen.
Ist vorgesehen, dass bei voller Auslastung des Sonnenhofs Tiere gegen Tagsatz auch bei privaten Vereinen untergebracht werden?
Haider-Wallner: Es gibt eine solche Lösung bereits für Hunde. Ich will da jetzt nichts vorwegnehmen, aber eine Ausweitung ist sicher ein Vorschlag, den man gut diskutieren kann.
Finanzielle Belastung für Ehrenamtliche
Trifft es zu, dass das Land den Sonnenhof jährlich mit 1,7 Millionen Euro fördert?
Haider-Wallner: Ja.
Ehrenamtliche und private Vereine finanzieren ihre Tierschutzarbeit aus eigener Kraft bzw. durch Spenden. Fördermöglichkeiten waren bislang – wenn überhaupt vorhanden – eher intransparent. Gibt es hier Änderungen?
Haider-Wallner: Aktuell bringen wir eine Richtlinie für Förderungen an Tierschutzvereine und Ehrenamtliche auf den Weg. Damit wird es einen klar definierten Prozess geben, wie Tierschützer:innen zu Unterstützungsleistungen kommen. Für den laufenden Betrieb müssen Rechnungen eingereicht werden, ebenso bei Umbaumaßnahmen. Die Summen sind zwar nicht hoch, aber die Richtlinie schafft einen Rechtsrahmen und damit Rechtssicherheit für die Vereine. So wissen sie, wo sie die Förderung beantragen, welche Kriterien gelten, was zu tun ist und welche Beträge sie erhalten. Mit dieser Richtlinie werden alle gleich behandelt und die Bedingungen, um an eine Förderung zu kommen, werden für alle transparent.
Verbesserte Bedingungen für Hoftiere
Ein Schwerpunkt der GRÜNEN war es immer, die Haltungsbedingungen von Schweinen und Rindern zu verbessern. Welche Änderungen möchten Sie bewirken?
Haider-Wallner: Ich besuche viele Tierhaltungsbetriebe im Burgenland. Wir planen gerade eine Erweiterung der Bio-Mutterkuhprämie, damit mehr Mutterkühe Naturschutzflächen beweiden, was Lebensraum für Tiere und Insekten schafft. Wir arbeiten hier eng mit der Landwirtschaftskammer zusammen, um die Bedingungen zu verbessern – auf Augenhöhe mit allen Beteiligten. Auch wenn es in der Vergangenheit Konflikte und unterschiedliche Sichtweisen gab, ist es wichtig, sich respektvoll alle Positionen anzuhören, um gemeinsam Verbesserungen zu erreichen.
„
Die meisten Menschen wünschen sich, dass Schweine gut gehalten werden,
greifen im Supermarkt aber dennoch oft zum billigsten Packerl.
„
LH-Stv. Anja Haider-Wallner
Wofür stehen Sie dann in der großen burgenländischen Diskussion? Bio oder regional?
Haider-Wallner: Bio UND Regionalität sind mir immer wichtig. Im Idealfall erreichen wir unsere im Zukunftsplan 2030 gesetzte Quote von 50 Prozent Bio – aktuell liegen wir bei 40 Prozent. Das ist ein ambitioniertes Ziel. Gerade in Zeiten, in denen die Preise für Bioprodukte fallen, muss man im Blick behalten, wie die Betriebe überleben können. Wir überlegen daher, wie wir regionale Bioprodukte im Land gut verwenden und so bereitstellen können, dass sie auch konsumiert werden. Ein Beispiel ist ein Projekt von „Urlaub am Bauernhof“, bei dem in Bauernhöfen Fremdenzimmer vermietet und Bio-Frühstück aus dem Burgenland serviert werden wird.
Dennoch ist das nur ein kleiner Bereich und nicht für jeden Biohof geeignet.
Haider-Wallner: Es sind viele kleine Bausteine, und wenn ich in den letzten Monaten eines gelernt habe, dann, dass es viel Bohren dicker Bretter braucht, um zu guten Lösungen zu kommen. Die Frage ist, wie man Bio stärker fördern kann, denn für viele ist es trotzdem eine Kostenfrage. Wichtig ist uns, dass wir Maßnahmen umsetzen, wie im Regierungsprogramm vereinbart – etwa die Mutterkuhprämie für Biobetriebe. Diese werden wir nun ausweiten, sodass auch konventionelle Rinderhaltungsbetriebe diese Förderung erhalten, wenn sie Naturschutzflächen beweiden.
Spitzmüller: Bio ist dem Land Burgenland schon lange sehr wichtig, und wir gehören österreichweit zu den Spitzenreitern. In Kindergärten und Schulen gibt es inzwischen eine Verpflichtung zu einem bestimmten Bioanteil – hier ist bereits viel passiert. In vielen Bäckereien decken sich Regionalität und Bio. Bei Bio gibt es klare Regelungen und Kontrollen, sodass man sich auf die Qualität verlassen kann. Regionalität ist hingegen schwieriger zu definieren. Für mich ist Vorarlberg zum Beispiel nicht mehr regional, auch wenn es zu Österreich gehört – Ungarn ist geografisch näher. Letztlich muss jeder selbst festlegen, was er unter „regional“ versteht.
Haider-Wallner: Vor zwei Wochen waren wir bei einer Bio-Schweinebäuerin und haben darüber diskutiert. Die meisten Menschen wünschen sich, dass Schweine gut gehalten werden, greifen im Supermarkt aber dennoch oft zum billigsten Packerl. Diese Diskrepanz muss aufgelöst werden. Vielleicht muss es nicht jeden Tag ein Schnitzel geben, sondern nur am Sonntag – dafür zahlt man dann wahrscheinlich mehr, weiß aber, dass es dem Tier halbwegs gut gegangen ist. Die Entscheidung liegt letztlich bei den Konsumentinnen und Konsumenten. Deshalb müssen wir einerseits die Rahmenbedingungen für die Umstellung auf Bio verbessern – etwa durch Förderungen oder andere Instrumente – und andererseits Bewusstsein schaffen.
Wichtig sind auch Regelungen, damit burgenländische Bioprodukte in der öffentlichen Beschaffung verwendet werden – in Kindergärten, Schulen und Krankenhäusern. Zusätzlich braucht es Anreize, zum Beispiel gemeinsam mit der Wirtschaftskammer eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie einzuführen. Das ist ein großer Hebel, denn importiertes Billigfleisch wird hauptsächlich in der Gastronomie verwendet, wo Konsumentinnen und Konsumenten keine Wahl haben. Sie können zwar nachfragen und hartnäckig bleiben. Wenn viele Gäste immer wieder wissen wollen, woher das Fleisch stammt – ob es österreichisch oder Bio ist – steigt die Chance, dass Wirte transparent werden. Das wäre eine große Gelegenheit.
Spitzmüller: Also bei uns im Landhaus zum Beispiel gibt es einen Monitor, wo welches Produkt herkommt. Und ja, das wäre natürlich schön, wenn wir es überall hätten. Wir stehen an der Seite der Bauern, weil die möchten natürlich nicht, dass wir Fleisch aus der Ukraine und aus Holland und aus Argentinien auf den Speisekarten haben.
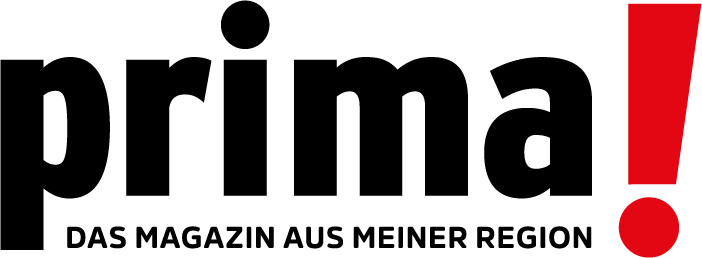
Schreiben Sie einen Kommentar