Nicole MATSCH / 25. September 2025
© Nicole Matsch
Hunderttausende Österreicher:innen mit Erstsprache Deutsch können nicht sinnerfassend lesen. Dieser Mangel an Lese- und Schreibkompetenz heißt funktionaler Analphabetismus.
Zahlen, die aufrütteln
Österreich versteht sich als Land mit gut ausgebautem Schulsystem und langer Bildungstradition. Dass hunderttausende Erwachsene Schwierigkeiten mit dem sinnerfassenden Lesen haben, passt nicht ins Bild. Doch die Daten sind eindeutig: Laut der internationalen PIAAC-Erhebung (2022/23), 2024 veröffentlicht von Statistik Austria, verfügen hierzulande 1,7 Millionen Menschen über niedrige Lesekompetenzen. Das entspricht 29 Prozent der 16- bis 65-Jährigen – fast jede dritte Person dieser Altersgruppe. Vor elf Jahren lag der Anteil noch bei 17 Prozent. Besonders alarmierend: Auch Menschen, die in Österreich geboren wurden und Deutsch als Erstsprache sprechen, sind betroffen. Bei ihnen stieg der Anteil von 12 auf 19 Prozent.
Tabu Bildungsarmut
Dr.in Christine Teuschler, langjährige Geschäftsführerin und nun Vorstandsvorsitzende der Burgenländischen Volkshochschulen, kennt die Situation: „Die erste große Herausforderung ist, dass man sich in unserer Gesellschaft grundsätzlich – und so auch im Burgenland – nicht vorstellen kann, dass das Thema Analphabetismus eine Relevanz hat; dass jemand, der bei uns das Schulsystem durchlaufen hat, Probleme mit Lesen und Schreiben haben kann.“ Seitens der Politik richte man den Blick eher auf die Höherqualifizierten und sei stolz auf den Aufholprozess und die positive Bildungsentwicklung im Burgenland, so Teuschler weiter. Sie wünscht sich eine Enttabuisierung des Themas und eine stärkere Verankerung im gesellschaftlichen Bewusstsein. Denn über jene, die den Anschluss verlieren, rede kaum jemand.
Scham, Angst und der steinige Weg zur Hilfe
Die Ursachen von funktionalem Analphabetismus sind vielfältig: Manche bekamen in der Schule zu wenig Unterstützung, andere wuchsen in bildungsfernen Familien auf oder brachen die Ausbildung früh ab. Über Jahre fehlt dann die Übung, manchmal verschärft durch gesundheitliche Probleme oder Migrationshintergrund.
Warum Betroffene selten Hilfe suchen? Weil sie nicht nur mit den praktischen Schwierigkeiten in Alltag und Beruf kämpfen, sondern auch mit der Scham und dem Vorurteil, sie seien „dumm“. Viele haben Strategien entwickelt – die vergessene Brille, eine verletzte Hand –, um ihre Defizite zu verstecken. Immer in Angst, entdeckt zu werden. Für Menschen mit Migrationshintergrund, die Deutsch erst lernen, ist die Hemmschwelle oft geringer – sie nehmen Bildungsangebote eher an, weil ihre Situation gesellschaftlich sichtbarer und weniger stigmatisiert ist. „Gegenüber einer fremden Person einzugestehen, dass man Probleme mit der Schriftsprache hat, kann eine Bedrohung darstellen“, sagt Christine Teuschler. Deshalb seien Vertrauen und niederschwellige Angebote – besonders in ländlichen und peripheren Regionen – entscheidend. Die Volkshochschulen Burgenland versuchen mit Projekten wie der „LernBar“ einen geschützten Rahmen für Betroffene zu schaffen. Dort gibt es Einzel- oder Kleingruppenunterricht, flexibel und kostenlos. Finanziert wird das Angebot im Burgenland durch das Land und den Europäischen Sozialfonds.
Damit die Unterstützung ankommt, arbeiten Volkshochschulen mit AMS, Sozialämtern und Beratungsstellen zusammen. Wichtig seien Vertrauenspersonen wie Lehrkräfte oder Sozialarbeiter:innen, die Schwierigkeiten früh bemerken und den Kontakt zu passenden Angeboten herstellen. So werde der erste Schritt überhaupt möglich.
Österreich im OECD-Vergleich
Der internationale Vergleich zeigt die Dramatik der Situation: Österreich erreicht in der PIAAC-Erhebung 254 Punkte bei der Lesekompetenz und liegt unter dem OECD-Schnitt von 260. Länder wie Finnland, Dänemark oder Norwegen erzielen weit über 280 Punkte. In Mathematik liegt Österreich hingegen mit 267 Punkten über dem Durchschnitt.
Weniger Buchstaben, mehr Emojis
Neben dem Bildungsstand nimmt heute auch die digitale Kommunikation Einfluss auf den Umgang mit Sprache. Laut Jugend-Internet-Monitor 2025 von Saferinternet.at ist WhatsApp die wichtigste Plattform für Jugendliche. Eine Marketagent-Studie 2024 zeigt: Über 70 Prozent der Generation Z kommunizieren bevorzugt über Emojis, Bilder und Sprachnachrichten, oft mit Textfragmenten statt in ganzen Sätzen. Auch Erwachsene nutzen immer häufiger Emojis oder knappe, fehlerhafte Nachrichten. Das senkt zwar die Hürde, sich mitzuteilen, nimmt aber gerade für Menschen mit ohnehin schwacher Lesekompetenz die Übung im Lesen und Schreiben. Pädagog:innen warnen vor einer „sprachlichen Verkürzungskultur“.
Hoffnungsträger Volkshochschulen
Rund um den 8. September, dem Weltalphabetisierungstag, haben die Volkshochschulen mit Aktionen und offenen Lernangeboten auf das Problem „Funktionaler Analphabetismus“ aufmerksam gemacht. Sie zeigen damit jedes Jahr: Alphabetisierung ist kein Randthema, sondern eine Daueraufgabe – auch in einem Land wie Österreich. Christine Teuschler fordert daher: „Für eine nachhaltige Gestaltung der weiteren Alphabetisierungsarbeit bräuchte es mehr Planungssicherheit für die Anbieter und ein Bekenntnis der Politik zur grundlegenden Finanzierung möglichst flexibler Angebote zum Nachholen von Bildungsdefiziten.“

Dr.in Christine Teuschler, Vorstandsvorsitzende der Burgenländischen Volkshochschulen, fordert eine Enttabuisierung und mehr gesellschaftliches Bewusstsein für funktionalen Analphabetismus.
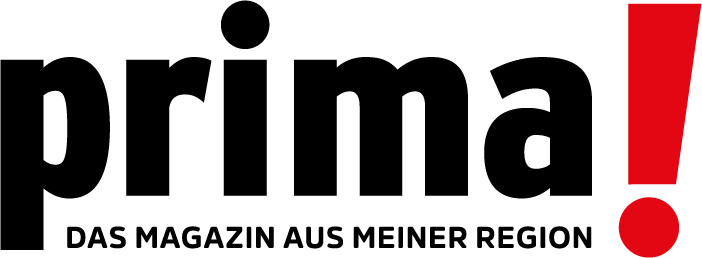
Schreiben Sie einen Kommentar