Chiara PIELER / 24. September 2025
© unsplash
Ab dem 80. Lebensjahr ist etwa jede fünfte Person von Demenz betroffen.
Alterserscheinung mit weitreichenden Folgen
Demenz ist keine Krankheit, die plötzlich über Nacht kommt. Vielmehr handelt es sich um einen schleichenden Prozess, der sich über viele Jahre entwickelt. Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko deutlich: „Ab dem 80. Lebensjahr ist etwa jede fünfte Person betroffen, ab dem 90. sogar jede zweite oder dritte“, erklärt Dr. Klaus Peter Schuh. Der Grund liegt in der natürlichen Alterung des Gehirns, das – wie jedes andere Organ – im Laufe der Zeit an Leistungsfähigkeit verliert. Der demografische Wandel verstärkt diese Entwicklung zusätzlich. „Früher haben wir die 90-Jährigen gefeiert, heute stehen schon über 100-Jährige in den Zeitungen“, so der Mediziner.
Vom Vergessen zum Rückzug
Ein häufiges Frühzeichen sei die Kombination aus Gedächtnisproblemen und Orientierungslosigkeit. Während gelegentliche Wortfindungsstörungen oder das Vergessen von Terminen im Alter normal sind, ziehen sich Menschen mit Demenz oft zurück – aus Angst, in sozialen Situationen zu versagen. Diese Reaktion hat auch eine biologische Komponente, wie Schuh erklärt: „Die Amygdala, das Angstzentrum im Gehirn, stuft bei Demenz Situationen schneller als bedrohlich ein.“ Daraus entstehe Unsicherheit – und letztlich sozialer Rückzug. Das Tragische daran: Gerade soziale Kontakte sind ein zentraler Schutzfaktor gegen Demenz.
Struktur gibt Halt – auch im fortgeschrittenen Stadium
Ein strukturierter Tagesablauf hilft Betroffenen, sich zu orientieren und reduziert Stress. Vom gemeinsamen Frühstück über kleine Aufgaben im Haushalt bis hin zum täglichen Spaziergang – jede Routine bietet Halt. Wichtig sei laut Schuh, „Menschen mit Demenz so viel wie möglich selbst machen zu lassen, aber dort zu unterstützen, wo ein Schritt nicht mehr funktioniert.“ Oft scheitern Handlungen nicht am Wollen, sondern an der Unfähigkeit, komplexe Abläufe zu rekonstruieren. Zahnpflege oder Kaffeekochen können so zu unüberwindbaren Herausforderungen werden – mit Frust auf beiden Seiten. Begleitung statt Überforderung lautet daher seine Devise.
Die Sprache der Empathie
Wer mit Demenzkranken kommuniziert, sollte nicht nur geduldig sein, sondern auch bewusst formulieren. „Kurze Sätze, Ja/Nein-Fragen, Wiederholungen – auch das hilft, Stress zu vermeiden“, betont Dr. Schuh. Denn bei Überforderung steigt Kortisol, das wichtigste Stresshormon, was wiederum zu Unsicherheit, Aggression oder Rückzug führen kann. Auch Angehörige selbst geraten dann unter Druck. Deshalb rät der Experte: „Nicht versuchen, alles allein zu bewältigen – und Hilfe annehmen, bevor man selbst krank wird.“
Tagesstruktur und Betreuung entlasten Familien
Ein erfolgreiches Modell ist der Seniorengarten Oberwart, den Schuh seit 2007 mitentwickelt hat. Die Tagesbetreuung bietet Raum für gemeinsames Tun – von Kochen über Spiele bis zu Spaziergängen. Rückmeldungen zeigen: „An Tagen, an denen die Betroffenen dort betreut werden, sind sie am Abend deutlich ruhiger.“ Zusätzlich gibt es Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz, in denen therapeutische Maßnahmen wie Ergotherapie oder Logopädie den Alltag begleiten. Das Ziel: Stabilität und Selbstständigkeit so lange wie möglich erhalten.
Forschung bringt Fortschritte, aber keine Heilung
Warum gibt es noch immer kein Heilmittel? Laut dem Allgemeinmediziner im Ruhestand liegt das an der komplexen Entstehung der Erkrankung. Zwar gibt es ein seit Kurzem zugelassenes Medikament, das bestimmte Eiweißablagerungen (sogenannte Plaques) abbauen kann, „aber es hilft nur in sehr frühen Stadien und bringt erhebliche Nebenwirkungen mit sich.“ Ein zentraler Risikofaktor ist die Schädigung der Blut-Hirn-Schranke im Alter. Schadstoffe gelangen dadurch leichter ins Gehirn und verursachen Entzündungen. Neben genetischen Dispositionen spielen auch Bluthochdruck, Übergewicht, Luftverschmutzung und Diabeteserkrankung eine Rolle.
Prävention: Was wir selbst tun können
Schuh betont, dass Prävention möglich ist – wenn auch nicht absolut. Ausreichend Bewegung, gesunde Ernährung, soziale Teilhabe und der Verzicht auf Rauchen und übermäßigen Alkoholkonsum können helfen. Wichtig sei auch die frühe Versorgung bei Hörverlust: „Unbehandelte Schwerhörigkeit beschleunigt den geistigen Abbau.“ Das Gehirn müsse wie ein Muskel behandelt werden. Es brauche regelmäßige Herausforderungen und Training, um möglichst lange leistungsfähig zu bleiben.
Sprechen hilft – Schweigen schadet
Der wichtigste Rat von Dr. Klaus Peter Schuh richtet sich direkt an Angehörige: „Reden Sie über die Demenz, statt sie zu verschweigen.“ Scham sei nach wie vor ein großes Hindernis für offene Gespräche. Dabei sei es wichtig, die betroffenen Menschen nicht zu verstecken, sondern wertschätzend einzubinden.
Ein regelmäßiges Demenzcafé im VIVIO Treff, das er gemeinsam mit Pflegeexpert:innen organisiert, bietet Raum für Austausch, Information und Entlastung. Angehörige und Betroffene kommen zusammen, hören Vorträge, teilen Erfahrungen – und merken, dass sie mit ihren Sorgen nicht allein sind.
„Demenz ist ein Weg – manchmal gut begehbar, dann wieder holprig“, so der Experte. Wer diesen Weg nicht allein geht, sondern ihn gemeinsam mit Angehörigen und Fachkräften beschreitet, kann ihn würdevoll gestalten. Das bedeutet auch: offen mit der Diagnose umgehen, Hilfe annehmen und Strukturen schaffen, die Halt geben.
„Ich bin wer ich bin, ich bin was ich bin, ich bin wie ich bin – und ich bin durch dich“, lautet sein Leitsatz, der in den Demenzeinrichtungen in Oberwart gelebt wird. Ein Satz, der nachklingt.

Dr. Klaus Peter Schuh vor dem VIVIO Treff in Oberwart. Hier veranstaltet er monatlich ein Demenz-Café mit
wechselnden Themen, bei denen sich Angehörige sowie Betroffene mit Expert:innen austauschen können.
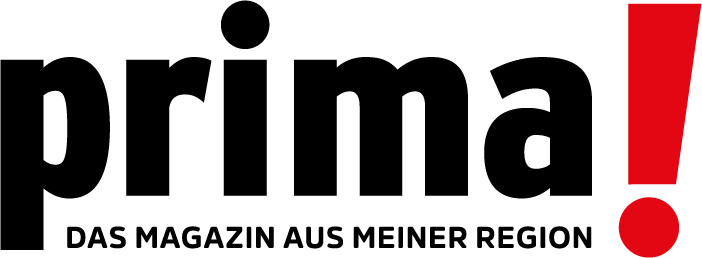
Schreiben Sie einen Kommentar