Das Rätsel von Rechnitz
Vor 75 Jahren ereignete sich bei Rechnitz in den letzten Kriegstagen ein Massaker, bei dem etwa 200 jüdische Zwangsarbeiter ermordet wurden. Die Mörder hatten zuvor an einem NSDAP-Fest im Schloss Batthyány teilgenommen. Die Hauptverdächtigen flüchteten und wurden nie gefasst. Der Tatort wird in der Nähe des Kreuzstadls vermutet. Dort betreut der Verein RE.F.U.G.I.U.S die Gedenkstätte für alle Opfer des Südostwallbaus und einen Informationsbereich. Die Grabstelle(n) wurde(n) bis heute nicht gefunden. Schon seit mehreren Jahren untersucht das Bundesdenkmalamt das in Frage kommende Gelände. Auch heuer war wieder ein Team von Archäologen im Einsatz. prima! stellt dem Experten Mag. Nikolaus Franz jene Fragen, die rund um das Rätsel von Rechnitz immer wieder auftauchen.
Foto: Kreuzstadl Droneservice - Mike Ritter
Luftaufnahme des Kreuzstadls
Seit Jahrzehnten wird bei Rechnitz – mit verschiedensten Verfahren – nach den Gräbern der Opfer des Massakers gesucht. Warum bisher ohne Erfolg?
Nikolaus Franz: Dies hat mehrere Gründe. Zum einen bieten die zur Verfügung stehenden historischen Quellen keine punktgenauen geografischen Hinweise. Oder anders ausgedrückt: auf Basis von Zeugenprotokollen, behördlichen Aktenvermerken und angefertigten Geländeskizzen kommen eine Reihe nicht deckungsgleicher Orte in Frage. Dies führt zu einer sehr großen Verdachtsfläche, die sich im Kern auf etwa 30 Hektar erstreckt. Zum zweiten existiert ein stetig anwachsendes Konvolut an Meinungen und Hypothesen über den Ablauf des Verbrechens, die sich wenig bis gar nicht auf bekanntes Quellenmaterial stützen, oftmals auf „Hören-Sagen“ beruhen und die Grabstelle mitunter weit außerhalb der Kernverdachtsfläche positionieren. Es benötigt also sehr viel Zeit, ein so großes Areal zu untersuchen. Es gab in der Vergangenheit zwar eine recht große Anzahl von Grabungen, die meisten dieser Suchkampagnen waren jedoch sehr kleinräumig angelegt. Das Bundesdenkmalamt änderte im Spätherbst 2017 diese Vorgehensweise. Seither wird das in Frage kommende Areal großflächiger untersucht. Die unter der Humusschicht befindlichen archäologischen Befunde werden systematisch und vollständig ergraben.
Welche Methoden wurden bisher bei der Suche angewandt?
Nikolaus Franz: Grundsätzlich ist zwischen zwei Methoden zu unterscheiden: Jene, die in den Boden eingreifen und solche, die das nicht tun. Bei einer Grabung wird die Humusschicht mittels Bagger vorsichtig entfernt. Im darunter anstehenden Lehm- oder Schotterboden zeichnen sich künstliche, durch Menschenhand getätigte Bodeneingriffe als Verfärbungen ab. In Rechnitz handelt es sich dabei oft um Panzer- und Laufgräben sowie Unterstände oder Bunker des sogenannten Südostwalls, einer zwischen Herbst 1944 und Frühjahr 1945 angelegten Verteidigungsanlage. Kommen diese Befunde aufgrund ihrer Größe als Massengrab in Frage, gräbt man in diese hinein. Durch Bohrungen erhält man Bohrkerne, die auf das Vorhandensein menschlichen Knochenmaterials untersucht werden. Zur zweiten Kategorie gehört die Interpretation bereits existierenden Luftbildmaterials sowie die Anfertigung neuer Luftbilder. Hierbei spielt der zum Zeitpunkt der Bildaufnahme herrschende Bodenbewuchs eine wichtige Rolle. An jenen Stellen eines Weizenfeldes beispielsweise, an welchen sich einst Gruben oder Gräben befanden, wachsen die Pflanzen in der Regel höher als auf dem Acker sonst üblich. Auf in passender Höhe aufgenommenen Bildern werden diese Objekte somit sichtbar. In die Gruppe dieser nicht-invasiven Methoden der Archäologie gehören auch das Bodenradar sowie die Geomagnetik, die es mittels bildgebender Verfahren ermöglichen, größere archäologische Befunde in den Bodenschichten aufzuspüren. Auch die „Airborne Laserscanning-Technologie“, durch die man das Relief einer Landschaft ohne Bewuchs darzustellen vermag, kann dabei helfen, Stellen zu finden, die als Ort des Grabes oder der Gräber in Frage kommen. Im Projekt Rechnitz kamen und kommen alle diese Methoden zum Einsatz.
Kann die Archäologie das „Rätsel von Rechnitz“ lösen?
Nikolaus Franz: Beim derzeitigen Stand der Dinge ist es nur möglich, die Opfer des Massakers mittels Ausgrabung zu finden. Das Studium der vorhandenen und die Erschließung neuer historischer Quellen, die Prüfung von in der Bevölkerung kursierender Theorien, die Interpretation der Luftbilder und auch die Auswertung geophysikalischer Prospektionen können uns nur zu Arealen führen, wo man erst recht die Schaufel ansetzen muss. Leider existieren meines Wissens keinerlei Möglichkeiten, vor 75 Jahren verscharrte Mordopfer ohne Eingriff in den Boden zu finden. Das Problem ist auch, dass sich viele Menschen erwarten, die Zusammenführung aller existierenden Hinweise würde zu einem bestimmten Punkt in der Landschaft führen, ähnlich des berühmten X auf einer Schatzkarte. Das funktioniert aber leider aus vielen Gründen nicht so einfach, da etwa die Angaben zum Ort des Verbrechens in den Zeugenaussagen sehr ungenau oder divergent sind. Noch dazu wurden diese Angaben von Polizei und Justiz nicht deswegen protokolliert, um den Ort des Grabes festzustellen, sondern um Mörder und Mittäter zu überführen. Die verhörten Personen hatten auch ganz unterschiedliche Motivlagen, über das Massaker zu sprechen. Beschuldigte äußerten sich bei einem Verhör natürlich in anderer Weise als dies beispielsweise überlebende Zwangsarbeiter taten. Anzunehmen ist, dass erstere vor allem danach trachteten, sich selbst nicht zu belasten, während Überlebende, die im März 1945 vom Lager Köszeg nach Rechnitz getrieben wurden, zwar einerseits Interesse an der Aufklärung des Verbrechens hatten, jedoch aufgrund ihrer oft nur sehr kurzen Verweildauer mit den örtlichen Begebenheiten sehr wenig vertraut waren.
Wie stehen derzeit die Chancen, die Opfer zu finden?
Nikolaus Franz: Manche Meinungen über den Verbleib der ermordeten ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiter gehen davon aus, dass die Opfer schon vor langer Zeit exhumiert und an anderer Stelle vergraben wurden. Man kann dies natürlich nicht ausschließen. Doch ist es nur dann möglich, solche Erzählungen bei der Suche zu beherzigen, wenn diese auf nachvollziehbaren Indizien oder auch eidesstattlichen Erklärungen beruhen. Beim derzeitigen Wissensstand gehen wir davon aus, dass sich die Opfer des Massakers noch immer dort befinden, wo sie 1945 verscharrt wurden. Ich bin optimistisch, dass diese auch gefunden werden und denke, man sollte keinesfalls die Geduld verlieren und weiterhin auf die Methode der systematischen Ausgrabung setzen. Dies immer auf Basis des umfangreichen Quellenmaterials sowie unter Verwendung sämtlichen Analysematerials, das Luftbildarchäologie und die geophysikalischen Prospektionsmethoden bieten.
Mag. Nikolaus Franz
studierte Sozialwissenschaften und Neuere Geschichte und arbeitet seit 2002 als archäologischer Grabungstechniker. Gemeinsam mit der Archäologin Judith Schwarzäugl und der Historikerin Astrid Tögel ist er Gesellschafter der „AGA – Arbeitsgemeinschaft Geschichte & Archäologie“, einer Agentur u.a. zur Planung und Umsetzung archäologischer Grabungs- sowie historischer Rechercheprojekte.
Die AGA führt im Auftrag des Bundesdenkmalamts, Abteilung Archäologie, das Projekt „Die Suche nach dem Massengrab in Rechnitz“ durch. Zuletzt produzierte die AGA den Dokumentarfilm „Eine Stadt unter dem Hakenkreuz. Schwechat 1938 – 1945“, der im Mai 2020 auf ORF III zu sehen war.
.
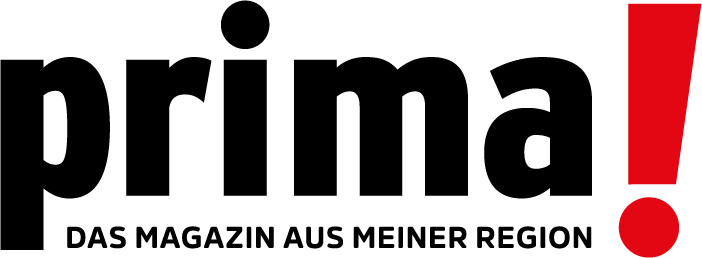



Schreibe einen Kommentar
1 Antworten
Das Rätsel von Rechnitz