Die „Corona-Kinder“ Eine depressive Generation?
Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie zehren an den Kräften von allen. Doch gerade den Kindern verlangt die Krise viel ab. Das gewohnte Gefühl einer allgemeinen Zukunftssicherheit und Berechenbarkeit der Welt nimmt rapide ab. Im Gegenzug nehmen depressive Symptome unter Kindern und Jugendlichen zu, die Rede von überfüllten Kinder- und Jugendpsychiatrien macht die Runde. „Wir sind gefragt wie sonst kaum“, sagt auch Andrea Maly-Scherf, niedergelassene Psychotherapeutin aus Hartberg.
Foto: Shutterstock / Ermolaeva Olga 84
Peter hat große Augen und vermutlich ein schiefes Lächeln. Doch unter der Maske sieht man das nicht. Ein kleines „Di“ ist am rechten Rand mit krakeliger Schrift auf der Maske vermerkt – die sieben Masken sind schließlich nach Wochentagen sortiert. Wie streng sehen das Peters Eltern denn, möchte man fragen. Doch Peters Eltern sind verzweifelt. Von ihnen aus muss Peter an der frischen Luft gar keine Maske tragen. Doch sobald die Wohnungstür aufgeht, streift sich der Junge mechanisch das vermeintlich rettende Stoffstück über und murmelt seinen Merkvers vor sich hin „Mo-Di-Mi-Do-Fr-Sa-So“, um abzuzählen, ob heute wirklich der Di-Tag ist. Will die Mutter eingreifen, schreit er und schlägt um sich. Peter ist bis dato ein unauffälliges Kind gewesen und gerade einmal acht Jahre alt. Er geht in die zweite Klasse. Also eigentlich ja nicht. Zum Zeitpunkt unseres Treffens ist die Schule geschlossen. Seine Mutter hatte ohnehin nur einen Aushilfsjob, der ist jetzt weg. Eigentlich ist sie froh darüber, denn dann kann sie in den Zeiten von Lockdown und Homeschooling für Peter da sein. Auch mal mit ihm rausgehen. Doch Peter will heute nicht. „So viele Menschen“ stößt er hervor und dreht um. Wieder heulen. Heute ist ein schlechter Tag, dabei wollte Peters Mutter mit ihm nur einkaufen gehen. Und alleinlassen kann sie ihn ja auch schlecht. Der Vater ist unterwegs, viele Kundenkontakte, kommt erst abends heim. „Dann riecht er nach Viren“, sagt Peter und weigert sich, ihn zu umarmen.
Erstarrt in Apathie
Bei Nina ist es viel ruhiger. „Wenn sie wenigstens schreien würde“, sagt ihre Mutter. Aber von Nina kommt kaum etwas. Apathisch liegt die 15-Jährige im Bett, starrt auf das Handy oder in eine Leere, die man dahinter nur erahnen kann. Eigentlich ist sie gerade im Online-Unterricht an der HLW. Früher war das Ninas großer Traum, erst die HLW, dann einen Studiengang Tourismusmanagement. Und dann die Welt bereisen. Und Tourismuskonzepte erarbeiten. Früher. Spricht man Nina jetzt auf ihre Zukunftspläne an, kommt nur ein Schulterzucken. „Hat doch eh alles keinen Sinn, die Wirtschaft geht den Bach runter, die Grenzen werden dicht gemacht und Geld zum Verreisen hat sowieso keiner mehr.“ Kaum hat sie das gesagt, wandert der Blick wieder aufs Handydisplay, in der Online-Schule ist gerade Fachwechsel. „Immerhin geht sie jetzt wieder in den Online-Kurs“, sagt die Mutter, „und sei es auch nur im Liegen.“ Und wenn sie als Praxisaufgabe etwas kochen sollen, macht Nina das auch. Meistens. „
Um Weihnachten herum waren wir so weit, dass ich Nina sogar das Essen gebracht habe, weil sie keinen Sinn mehr in irgendetwas sah.“ Die verlangten Lebkuchen für die Schule hat dann auch die Mutter gebacken und präsentiert. Dann kam der Zusammenbruch der Mutter. Zwischen selbst arbeiten, den Haushalt stemmen und die lebensunlustige Tochter versorgen, blieb sie selbst auf der Strecke: „Ich hatte eine kleine harmlose Grippe, doch ich saß einfach ein ganzes Wochenende in der Ecke und habe geheult.“ Da hat sie gemerkt, so kann es nicht weitergehen und für sich und ihre Tochter professionelle Hilfe gesucht.
Depression ist keine Schwäche
Doch was kann man tun? Corona-Maßnahmen, Ausgangssperren, Lockdown light und hard, die Aufforderung „Treffen Sie niemanden!“ stößt hier auf die Welt der Kinder und Jugendlichen. Da ist Spielen, Grenzen erkunden, sich selbst ausprobieren und die eigene Autonomie erproben angesagt. Doch wie kann man Autonomie erfahren, wenn sogar die Eltern von staatlicher Seite aus abends um 20.00 Uhr daheim sein müssen? Die zwei Familien aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, die lieber anonym bleiben wollen, sind keine Einzelfälle. Andrea Maly-Scherf kennt aus ihrer Praxis ähnliche Beispiele. „Depression wird leider immer noch als Schwäche gesehen, dabei sind das ganz normale, von der Entwicklung des Menschen her gesehen sinnvolle Reaktionen auf eine absolut nicht normale Situation“, so die Therapeutin: „Suchen nach einer sozialen Bindung, jemanden, der einem Sicherheit vermittelt, Totstell- oder Fluchtreflex.“ Natürlich gibt es viele, die ein gesundes Umfeld und schützende Faktoren, also eine hohe sogenannte Resilienz haben. Doch die schützt auch nicht vor allem. Von Lockdown zu Lockdown konnte sie einen Anstieg der Fälle in ihrer Praxis wahrnehmen, Kollegen erging es ähnlich.
Was kann man tun?
„Sicherheit vermitteln und die Grenzen des Möglichen ausschöpfen, sprich, sich die erlaubte Vertrauensperson suchen und diese wirklich öfter mal sehen, rausgehen, sich bewegen, vielleicht mit Abstand im Freien auch jemanden treffen und ganz wichtig: drüber reden. Aussprechen nimmt Angst und dieses Gefühl der Ohnmacht ein bisschen von uns.“ Gleichzeitig aber dem Thema „Corona“ nicht zu viel Raum geben, das Stichwort „Medienfasten“ fällt. Für die Eltern hat sie auch eine ganz wichtige Botschaft: „Loslassen. Sich nicht komplett für alles verantwortlich fühlen, dem Kind bzw. vor allen dann den Jugendlichen innerhalb dessen, was möglich ist, Freiräume schaffen, z.B. dadurch, dass man sie auch in alltägliche Arbeiten einbindet. Wenn ein Jugendlicher z.B. kochen kann, muss er sich nicht an familiäre Essenszeiten halten; wenn er seinen Tag selbst strukturieren darf, selbst wenn er eventuell dafür Probleme mit einem Lehrer bekommt, weil er die Aufgabe nicht rechtzeitig abgegeben hat, wird er das verkraften. Aber wenn diese Person dann aus eigenem Antrieb heraus beim nächsten Mal pünktlich abgibt, gibt das auch ein Gefühl der Selbstermächtigung und der Kontrolle.“
Für Andrea Maly-Scherf, die sich selbst als „systemtherapeutische Optimistin“ bezeichnet, ist die jetzige Kinder- und Jugendschar übrigens keine „verlorene Generation“, sie gewinnt der Situation auch Positives ab in Bezug auf Eigenorganisation und Medienkompetenz, die zwangsläufig erlernt werden. Doch die psychischen Folgen der Corona-Maßnahmen, die werden uns wohl noch lange begleiten.
Braucht mein Kind eine Psychotherapie?
Zunächst einmal sollte man abklären, ob eine Psychotherapie (PT) in Frage kommt. Dies kann beim Hausarzt geschehen oder auch vorab schon beim ausgewählten Therapeuten. In einem Erstgespräch wird abgeklärt, ob eine PT aktuell hilfreich ist und ob ein Vertrauensverhältnis zwischen Therapeut*in und potenziellen Klient*innen entstehen kann. Falls es noch keine Überweisung vom Hausarzt gibt, muss dies spätestens nach dieser ersten Abklärungsstunde geschehen. Zunächst werden maximal zehn Sitzungen von der Krankenkasse verschrieben, es kann aber um Verlängerung angesucht werden.
In Akutfällen kann man sich mit seinem Kind auch an die Kinder- und Jugendpsychiatrische Ambulanz am LKH Hartberg wenden (Termine unter telefonischer Vereinbarung von Mo–Fr von 8–16 Uhr unter 03332/605-2480) bzw. an die Kinder- und Jugendpsychiatrie Oberwart (Tel.: 03352/31 676)
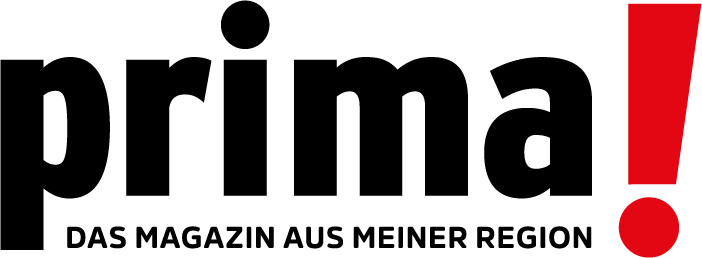


Schreibe einen Kommentar
1 Antworten
Die „Corona-Kinder“ Eine depressive Generation?