Wenn Gräber vom Leben erzählen
Im kleinen beschaulichen Örtchen Burg, nahe dem südburgenländischen Eisenberg, hat zu prähistorischen Zeiten ein reges Treiben geherrscht. Das Vorkommen des begehrten Eisens nahmen die Menschen zum Anlass, sich in der Region anzusiedeln. Funde aus Schandorf und Umgebung deuten auf internationalen Handel und die Nutzung der Rohstoffe der Region hin. Als Bestattungsform galt die Brandbestattung unter Grabhügeln. Diese hügeligen Zeitzeugen existieren vielerorts immer noch, in Schandorf sind sie besonders gut erhalten und gelten als die größten Hügelgräber Europas.
Fundstücke vom Neolithikum bis in die frühe Neuzeit belegen die jahrtausendelange Besiedelung
„Die meterhoch aufgeschütteten Erdhügel über den Verstorbenen, die innerhalb der Höhensiedlung von Burg gelebt haben, sollen auf den Reichtum und den Einfluss dieser Menschen hindeuten. Die Toten wurden mit Kleidung, Schmuck und sonstigen Habseligkeiten auf dem Scheiterhaufen verbrannt und dann bestattet. Über dem Grab wurde ein Erdhügel aufgeschüttet, je wohlhabender die Person, desto breiter und größer”, schildert Ortsvorsteher von Burg, Wolfgang Muhr. Diese Höhensiedlung in Burg ist durch großflächige, mehrphasige Wehrmauern und Wallanlagen befestigt. Aufgrund der Größe und der mächtigen Wälle hat es sich um eine der größten Wehranlagen Europas gehandelt. „In den 1950er-Jahren wurde sie zuletzt archäologisch mit Grabungsarbeiten untersucht, bevor das EU-kofinanzierte Projekt ArcheON die neuen Grabungen im Jahr 2020 möglich gemacht hat.”
Rückschlüsse aufs damalige Leben
Durch diese Grabungen sollen Festungen, Gräber und Spuren des ehemaligen Bergbaus einer längst vergessenen Zeit zu Tage kommen, um Aufschluss über das Leben von damals zu geben. Aus den Grabbeigaben lassen sich Rückschlüsse auf das Leben und manche Verhältnisse zur Römerzeit erzielen. Fakt ist auch, dass die Wehranlage strategisch klug auf der Spitze des Steilhanges in Burg gebaut wurde, um vor Angreifern geschützt zu sein. Auf einem eigens angelegten archäologischen Rundweg in Burg kann man die Fundstellen besuchen.
Über die Siedlungsweise kennt man allerdings wenig, da die Dörfer und Häuser der damaligen Zeit nicht erhalten sind. Als Ursache wird vermutet, dass die Häuser im waldreichen südlichen Burgenland wohl hauptsächlich aus Holz und Hüttenlehm gebaut waren und daher heute nur schwer archäologisch nachweisbar sind.
Skelettfund
Aber über einen Sensationsfund durfte sich das Team rund um das Projekt ArcheON dennoch freuen. „Im Zuge der Grabungsarbeiten wurde etwas außerhalb der Hügelgräbersiedlung ein gut erhaltenes männliches Skelett gefunden. Der Mann wurde vermutlich im Jahr 1099 n. Chr. zu Tode gefoltert. Die zahlreichen Knochenbrüche deuten auf die damals gängige Foltermethode des ‘Räderns’ hin, welches als Bestrafung für ein wirklich schweres Vergehen stand”, erzählt Wolfgang Muhr. Die Hügelgräber sind inzwischen denkmalgeschützt. Die historischen Fundstücke werden derzeit weiter untersucht, um mehr über das Bauen und Wohnen sowie Leben und Sterben der Vergangenheit zu erfahren.
Schon zu Beginn des 6. Jahrtausends vor Christus ist die jungsteinzeitliche Besiedelung des Schandorfer Gebietes durch archäologische Funde nachgewiesen. Zur Zeit der sogenannten „Eisenfürsten“ oder „Eisenbarone“ etwa 750 v. Chr. war Schandorf am wohlhabendsten. Das Schmelzen und Vermarkten des damals erfundenen neuen Metalls Eisen machte die Bevölkerung sehr wohlhabend. Vom damaligen Reichtum und der dichten Besiedelung an der Pinka zeugen noch heute die Hügelgräber im Schandorfer Wald. Die vom 8. bis ins 6. Jh. v. Chr. angelegten Hügelgräber gehören wegen der auffallend großen und gut erhaltenen Hügel zu den bedeutendsten Europas. Die einzigartige Bedeutung der Schandorfer Hügelgräber resultiert aus der Ansammlung von 285 bis zu 16 m hohen und bis zu 40 m breiten Riesengrabhügeln aus der Älteren Eisenzeit. Zusätzlich gibt es noch zwei Gruppen römischer Hügelgräber, die vom damaligen Reichtum der Region zeugen. 1878 wurden die Schandorfer Grabhügel während eines archäologischen Kongresses erwähnt. Bis jetzt sind drei Gruppen mit insgesamt 170 Grabhügeln bekannt. www.burgenland.info
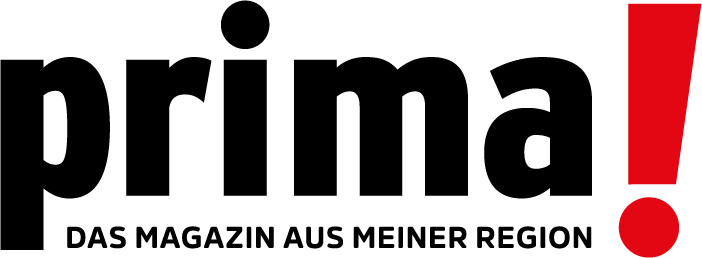


Schreibe einen Kommentar
1 Antworten
Wenn Gräber vom Leben erzählen